 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

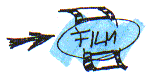
FILM - REVIEWS:
Für
meine aktuellen Kritiken bitte den Freizeit-Channel auf WorldOnline
besuchen!
Bisher:
*
Grosse
Gefühle
Exklusiv
Phörpa
- The Cup
Sonnenallee
Komiker
Im
Juli
Shower
Gripsholm
O Brother,
Where Art Thou?
*
Film-Pitches![]()
![]() Film-Reviews
Film-Reviews
*
| TITEL | DATEN | KRITIK | KURZ & GUT (ODER SCHLECHT...) |
|
Eyes Wide Shut |
Drama, USA, 1999
R: Stanley Kubrick A: Stanley Kubrick, Frederic Raphael (nach Arthur Schnitzler's Traumnovelle) D: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack |

* Mein Interesse wurde aber geweckt, als ich den Ausschnitt sah, in dem Alice (Kidman) ihrem Mann Bill (Cruise) gesteht, dass sie vor einem Jahr einem Offizier begegnet sei, für den sie, ohne je ein Wort mit ihm gesprochen zu haben, auf der Stelle alles - Ehe, Kind, Zukuft - bedenkenlos hingegeben hätte. Dieses Gespräch und seine Konsequenzen wollte ich unbedingt sehen. Jetzt, nachdem ich den Film gesehen und eine Menge
Gedanken und Erläuterungen dazu gelesen habe, habe auch ich bemerkt,
dass der grösste Teil des Films auf eine gewisse Art "im Hintergrund"
abläuft. Alles ist voller Symbolik, alles ist sehr bedeutungsvoll
- die Farben der Tapete, die Masken, die Frisuren der Charaktere, jede
Note der Musik. Die eigentliche Geschichte des Films scheint eher ein relativ
nebensächliches Vehikel zu sein, das die verschlüsselten, wirklichen
Anliegen transportiert.
Zu Beginn des Films ist sie zweifellos hochinteressant
und spannend. Das Ehepaar Harford nähert sich in kleinen Schritten
unaufhaltsam einem tiefen Abgrund, von dem es zu Beginn noch kaum etwas
ahnt. Die Stimmung ist immer angespannt, ständig droht eine Situation
ins Verheerende zu kippen.
Zurück zur Geschichte: wirklich beeindruckend
ist, wie solch scheinbar unbedeutende Dinge wie ein einmalig gespürtes
Verlangen, ein heftiger Traum oder ein kurzer Kuss eine unglaublich erschütternde
Wirkung auf die Menschen haben können. Der kleinste Lufthauch bringt
uns aus der Balance. Das Geständnis Alice's ist gerade deshalb so
fesselnd, weil sie im Grunde nichts zu gestehen hat - zumindest
nichts, was nicht nur in ihrem Kopf geschehen wäre.
Hat man eben noch darüber gestaunt, wie kraftvoll
die Szenen zwischen Alice und Bill sind, obwohl die beiden nichts als reden,
hat man sich eben noch an dem ergötzt, was man "Woody Allen in Ernst"
nennen könnte (Allen war ja kurzzeitig für Cruise's Rolle vorgesehen...),
so wird man plötzlich in einen ganz anderen Film katapultiert; Bill,
der Ehemann, streift nach dem Gespräch mit seiner Frau im Schockzustand
durch die Stadt, und gerät schliesslich in eine aufwendig inszenierte
Sex-Orgie. (Und Alice verschwindet leider für eine lange Zeit komplett
von der Leinwand.)
Sodann tritt eine etwas konventionelle, wenn auch
gelungen inszenierte Verschwörungsgeschichte in den Vordergrund -
und man fühlt sich plötzlich in den Grisham-Thriller "Die Firma"
zurückversetzt, inklusive immerzu ungläubig starrendem Tom Cruise.
Gegen Ende folgen dann wieder ein paar Szenen
zwischen Alice und Bill wie man sie sich wünscht. Zwar hat ein Kritiker
nicht ganz unrecht, der einwendet, der geschilderte Traum sei beinahe penetrant
sinnbeladen und bedeutungsschwanger zum platzen. Aber zumindest geht die
Geschichte weiter.
Aber am Ende will ich mir dennoch keine abschliessende
Kritik anmassen. Ich konnte es sowieso noch nie akzeptieren, und werde
es auch bei diesem Film nicht tun, wenn mit dem Spruch um sich geworfen
wird, entweder "hasse man den Film oder man liebe ihn". Kein Film (und
auch kein Buch oder Musikstück) war je so elementar und "kristallklar"
aufgebaut, dass dieser Satz auf ihn zutreffen könnte. Es gibt an jedem
Film gute und schlechte Seiten, und es gibt für jeden Film Leute,
die ihn weder unerreichbar gut noch besonders schlecht fanden.
|
oder man hasst ihn ... oder aber man liegt wie ich irgendwo zwischendrin! |
|
Himalaya |
Drama, F, 1999
R: Eric Valli A: Olivier Dazat, ... D: Thilen Lhondup, Lhanka Tsamchoe, Gurgon Kyap, ... Link: Info & Interview |

* "Himalaya - Die Kindheit eines Karawanenführers" lässt sich nicht wirklich einordnen, und gerade das ist meiner Meinung nach seine Stärke. So ist der ganze Film sehr authentisch. Mitunter beinahe in unangenehmen Masse authentisch, weil man sich dann plötzlich bewusst wird, wie nahe man als Zuschauer dem kommt, was in einem Kommentar zu dem Film "Tibetophilie" genannt wurde. Jener verklärenden, unehrlichen Geisteshaltung, in der man vom warmen Kinosessel aus "zurück zur Natur" kommen will, ohne aber die damit verbundene Yak-Scheisse riechen zu müssen. Man hat auch mitunter den Verdacht, dass man nur das serviert bekommt, was man selbst erwartet - und dass man so die Mythenbildung fördert. Kommt man aber über diese unangenehmen Gefühle hinweg, oder findet man sich mit ihnen ab, ist es doch wunderbar zu wissen, dass die handelnden Personen eben wirklich "Personen" sind, wie Eric Valli betont, und keine Schauspieler. Anders als die vielen ebenfalls authentischen
Dokumentarfilme erzählt "Himalaya" aber auch eine (fiktive, wenn auch
einigermassen lebensnahe) Geschichte, und zwar nach allen Regeln der Kunst.
Die Dramaturige und die Figuren wecken nicht nur Interesse und Faszination,
sondern auch immer wieder Spannung, wie man sie aus dem Popcorn-Kino nicht
fesselnder kennt. Allerdings ist die Geschichte aus viel älterem,
dauerhafterem Holz geschnitzt als viele der typischen Abenteuer-Filme -
die Motive sind klassisch und unvergänglich; der Kampf der Generationen,
das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, Leben und Tod. Auch die Dialoge
scheinen in ihrer Zeitlosigkeit den ewigen Bergwipfeln nachzueifern, in
deren Schoss sie gesprochen werden. Es funktioniert nicht immer, aber manchmal
schon; "Gestern war er ein Kind." Punkt.
Nun, warum eigentlich nicht? Weshalb muss jeder
Film, der sich mit dem Himalaya und seinen Menschen beschäftigt, auch
auf dieses Thema zu sprechen kommen? Ist es nicht auch eine Art schreckenslüsterne
Nabelschau, wenn wir immer die Fehler der westlichen Zivilisation vorgeführt
bekommen wollen, um dann heuchlerisch ausrufen zu können: "Aha! Sogar
bis dahin haben wir unsere McDonaldisierung getrieben!" Natürlich
ist dies ein drängendes Problem, aber nicht das einzige, und es macht
nicht die ganze Welt aus. Die Menschen im Himalaya sollten uns auch unbeachtet
seiner interessieren - es ist also eine schöne Ausnahme, einmal ganz
und gar von der uns bekannten Welt abgeschnitten zu sein.
Zu erwähnen, nein, nachdrücklich zu
betonen
ist, dass "Himalaya", wie all die anderen "Himalaya-Filme", unglaublich
schön anzusehen ist. Das liegt zum einen daran, dass man in dieser
Landschaft die Kamera wohl beinahe überall aufstellen kann und immer
ein wunderbares Bild schiessen wird, zum anderen natürlich an der
Kameraführung. Schon die Anfangsszene ist atemberaubend, die Szenen
am See lassen einem kaum mehr blinzeln wagen, sie scheinen fast nicht von
dieser Welt zu sein.
|
die Geschichte spannend und bewegend - und leider etwas zu glatt abgerundet |
|
Star Wars Episode 1 - The Phantom Menace |
S-F, USA, 1999
R: George Lucas A: George Lucas D: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman Link: Endlose Diskussionen über Qualität, Sinn und Unsinn des Films |

* Aber dass dieses Prequel gleich derart vermasselt werden musste, ist unbegreiflich. 20 Jahre hat Lucas sich Zeit gelassen - Jahre, in denen übrigens einige Romanautoren und Computerspiel-Programmierer einige gar nicht so schlechte Stories im Star Wars-Universum angesiedelt haben -, und dann liefert er so eine bemüht konstruierte, peinliche Geschichte ab. Ein hirnrissiges, unglaubwürdiges Komplott, ein Junge, der mit sechs Jahren laut seinen Freunden schon "seit Jahren" an einem hochtechnisierten Pod-Racer rumbastelt und damit auch gleich ein bedeutendes Rennen gewinnt, Froschmenschen, die innert Tagen eine uralte Feindschaft leichten Herzens an den Nagel hängen - es ist, selbst wenn man einräumt, dass auch die ältere Trilogie eine nicht immer intelligente Geschichte erzählte, ein Trauerspiel. Aber auch im Detail wurde fast alles vermasselt,
was es zu vermasseln gab. Über Jar Jar kein Wort, aber warum müssen
selbst die Federation-Aliens eine so debile Aussprache haben, dass es beinahe
wehtut? Peinlich auch Anakins Mutter mit ihren Binsenweisheiten... "Du
kannst die Sonne nicht am Untergehen hindern!" Soweiso: erstaunlich, wie
holprig, trocken und schlicht langweilig die Dialoge sind - komisch, dass
Lucas von den Special Effects-Leuten eine solch fantastische Leistung verlangte
und selber dann offensichtlich nicht einmal bereit war, einigermassen sorgfältig
an dem Script zu arbeiten!
Selbst Elemente aus den alten, guten, den guten
alten Episoden werden ins Lächerliche gezogen: C-3PO etwa wurde vom
jungen Anakin-Blag gebaut! Und die Kraft der Jedi-Riter basiert nicht etwa
"nur" auf der das Universum zusammenhaltenden geheimnisvollen "Force",
sondern auch auf knuddligen Mini-Bakterien, die durch das Blut aller Lebewesen
wuseln! Dass die Probe darauf, ob jemand ein Jedi-Kandidat ist, wie ein
Doping-Test bei der Tour de France daherkommt, passt dann haargenau ins
soweiso zerstörte Bild.
(Übrigens wird es allen, die mit Star Wars bisher nichts am Hut hatten (man könnte auch sagen: denen nichts an Star Wars und seiner Magie liegt), vermutlich ziemlich gut gefallen.) |
Und verdient Lucas, was er damit jetzt verdient? |
|
The Matrix |
S-F, USA, 1999
R: Larry & Andy Wachowski A: Larry & Andy Wachowski D: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving Link: Whatisthematrix? |

* Was allerdings wirklichg wiederlich ist: solch eine Verherrlichung der Gewalt hab ich noch kein zweites Mal gesehen. Der Mörder im Racheengel-Gewand kennt nur eine Sprache; "We need guns." Zu cool, um pädagogisch unbedenklich zu sein? Man kann die in Zeitlupe Bienenschwarm-ähnlich umherfetzenden Patronenhülsen und die dichten Schneeschauer aus aufspritzenden Betonbröseln ja auch als rein ästhetische, gar humoristische Szenen auffassen - aber es bietet sich nicht wirklich an. Nun zur anderen Seite des Films. Neben dem Schwarz
der Sonnenbrilen, der Nokia-Handys und des Waffenstahls gibt es nämlich
eine interessante Geschichte - oder gleich zwei davon. Zum einen die Gedankenspielerei,
dass die Welt unserer Sinne nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Zum anderen die Story um Neo, der die tieferliegende Wahrheit erkennen
und den Menschen nahebringen kann.
Wie kann man das alles nun verstehen? Wie schon
bei "The Truman Show", der ein sehr ähnliches Thema behandelte, geht
es um das Individuum, das körperlich und geistig im Griff von Mächten
ist, die es nicht durchschaut, um die es vielleicht nicht einmal weiss
(Kafka im Regiestuhl...). Das Internet, das uns allen das Hirn verdreht
und am Leben hindert? Die "anonyme Gesellschaft", in der wir wehrlos versinken
müssen? Möglich, möglich.
Ungeachtet dieser Einwände ist "The Matrix",
der zweifellos sehr spannend, tricktechnisch atemberaubend und angenehm
schnell ist, auch anzurechnen, dass er solche Gedankengänge überhaupt
hervorruft. Filme wie diesen darf man also auch nicht einfach zum Getümmel
der "Science Fiction"-Filme rechnen und mit Effektspektakel wie "Species"
auf einen Haufen werfen. Er ist auch schlicht zu gut dazu.
|
mit fantastischen Effekten fürs nächste Jahrhundert - und dummen Gewaltorigen aus dem Neandertal |
|
Shall we dance? |
Comedy, Japan
1996
R: Masayuki Suo A: Masayuki Suo D: Koji Yakusho, Tamiyo Kusakari Link: Quicktime-Trailer |

* Er wurde, wie es anders
nicht denkbar ist, für diese Leichtigkeit auch kritisiert. So war
zu lesen, es sei kein Wunder, dass ein Film, der von Disney weltweit vertrieben
wird, so harmlos und süss daherkomme. Nun ist es erstens etwas fragwürdig,
einen Film danach zu beurteilen, von wem er vertrieben wird.
Der Hauptdarsteller Koji Yakusho hat durch seine Darstellung des unsicheren, sinnsuchenden Angestellten Sugiyama einen grossen Anteil daran, dass die Geschichte einem so zu Herzen geht. Aber auch die restlichen Darsteller sind wunderbar, man könnte sie sich kaum passender denken. Tamiyo Kusakari als feenhafte Tänzerin Mai, Sugiyama's Mutter und Tochter, der heimliche "Latin-Lover" vom Büro - diese Charaktere werden nie zu den so oft gesehenen, alten Schablonenmännchen, wie sie so viele Komödien bevölkern. Sie scheinen bei aller Komik (mitunter bei aller Tragik) echte, lebendige Menschen zu sein, die man übrigens kurz nach Verlassen des Kinos schon vermisst. Man kennt und teilt die Gefühle und Probleme, denen Sugiyama begegnet: der Ausbruch aus dem täglichen Trott, der schwere Kampf gegen Gewohnheit und Scham, die kleinen Sternstunden und grossen Sternminuten. Am schönsten sind vielleicht die beiden Liebesgeschichten: das stille, nie ausgesprochene Verliebtsein Sugiyama's in Mai und seine wiedergefundene, erneuerte Liebe zu seiner Frau. Die Welt ist nicht immer
ein sehr fröhlicher Ort, und so kann man fast jeder Komödie vorwerfen,
sie zeichne ein falsches Bild der Realität. Aber sollte man nicht
eigentlich froh darum sein, wenn bei aller Traurigkeit des Lebens hin und
wieder ein Film uns zeigt, dass "la vita" eben doch "bella" ist, oder wenn
er uns zum "dance" auffordert?
|
So gut! |
|
Duel |
Thriller, USA
1971
R: Steven Spielberg A: Richard Matheson D: Dennis Weaver Link: Spielberg
Database
|
* Ja aber auch, weil Spielberg unverändert vor allem für eine Sache bekannt war und ist: Spannung. Und spannend ist "Duel" ohne Zweifel. Die Geschichte - die man wohl getrost mit dem Prädikat "kafkaesk" versehen darf - von einem Mann (namens David Mann), der auf einer Autofahrt einem riesigen, schwarzen Lastwagen vorfährt und dann von diesem den ganzen Film über verfolgt, gehetzt, beinahe ermordet wird, ist einfach und man könnte meinen zu simpel, als dass sie über 90 Minuten hinreichen würde. Tut sie aber, vor allem aufgrund Spielberg's Gefühl für Einstellungen, Schnitt, Timing. Da ist es eigentlich schade,
dass der Mann mitunter "laut denkt", oder dass dramatische Geigenzupfermusik
das Auftauchen des unheimlichen schwarzen Lastwagens untermalt. Vermutlich
hätte der Film auch ohne diese Verdeutlichungen funktioniert, er hätte
aber noch authentischer gewirkt, wäre noch "filmischer" geworden.
Begrüssenswert finde ich, dass auf allzuviel Symbolik verzichtet wurde. Auch wenn manches da ist, das ins "innere Auge" fällt: Am Radio klagt ein Reporter über die ewig verstopften Strassen (die zu eng gewordene Welt?), ein verstörter Kerl dient (beim Klagen über seine herrsche Frau) als Beweis dafür, wie wenig der Mensch seine Umwelt eigentlich noch unter Kontrolle hat, der Fahrer, der vom Laster verfolgt wird, heisst zum Nachnamen "Mann", was uns allen erlaubt, uns mit ihm zu identifizieren, mit seinem Kampf gegen den gesichtslosen, übermächtigen Feind. Und beinahe scheitern tut Mann (also man, wir?) an eigener Unvorsicht - er lässt sich keinen neuen Kühlerschlauch einbauen, wo er doch mehrmals dazu ermahnt wird. Und doch, selbst wenn man
all diese Dinge sehr verschieden interpretieren kann, sie drängen
sich nie in den Vordergrund. Der Film hält sich nicht mit bedeutungsschwangeren,
endlos langen Einstellungen auf. Man zerbricht sich während dem Film
kaum den Kopf, "wofür der Lastwagen denn steht", man ist viel zu sehr
mit der klaren, einfachen Geschichte beschäftigt, die erzählt
wird: Ein Mann kämpft mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen um sein
Leben. Duell ist der Titel, Duell ist der Inhalt des Films.
Weshalb keine uneingeschränkte Begeisterung? Zum einen wegen der erwähnten Kritik an den gesprochenen Gedankengängen und der vermutlich überflüssigen Musik, zum anderen deshalb, weil der Film doch ein, zwei Längen hat: Der Lastwagen ist mal wieder weg, man weiss aber, dass er bestimmt wieder auftauchen wird, und darauf wartet man dann eben. Von dem Film existieren allerdings zwei Fassungen, eine von 90 Minuten fürs Kino, eine kürzere fürs Fernsehen. Vielleicht wäre die zweite gerade kurz und gerade lang genug. |
Mitreissend und in gutem
Sinne ungewohnt -
und ein wenig zu lang |
|
Tokyo Eyes |
Thriller,
Frankr. & Jap. 1998
R: Jean-Pierre Limosin A: Jean-Pierre Limosin D: Shinji Takada, Hinano Yoshikawa, Takeshi Kitano |
* Schliesslich geht es darin um einen jungen Typen (nur "K." genannt), der "verkleidet" mit einer - wenn auch harmlosen - Pistole auf Menschen schiesst. Und um das Mädchen (Hinano), welches ihn kennen- und wohl auch lieben lernt und mit ihm etwas ziellos durch die Monsterstadt Tokyo irrt. Aber man muss die Handlung
eigentlich nicht beschreiben, weil es in diesem Film viel mehr um die Stimmung
geht. Schon in der ersten Szene geht es los: Beinahe hypnotische Musik,
dazu ein schneller Gang durch Bahnhöfe, Bäder, Gassen, durch
eine Welt aus Lichtkleksen. Und man ist, wie ein Freund von mir richtig
bemerkte, immer ganz nahe dran, mittendrin. Kaum eine Totale, alles ist
eng, man schaut über Schultern und in Gesichter.
Diese unaufhörlich
hereinstürzenden Bilder sind es ja auch, die K. erst zur Waffe greifen
lassen. Er fühlt sich, wie er sagt, als habe er keine Lider, als könne
nichts die Bilderflut aufhalten. Und wer könnte dies in der Zeit des
Internets, der Talkshows, der Monica Lewinsky nicht nachempfinden?
Den Schluss könnte man ein Happy-End nennen, aber man würde ihm damit nicht gerecht. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie einfach die Antworten auf die Fragen des Lebens manchmal (immer?) sein können. Was machst du mit der neugekauften, silbern-glänzenden Pistole? Wirf sie weg! Was machst du, wenn du vom Schicksal verwundet und orientierungslos bist? Lebe weiter! Und der Film, der mit Pistolenschüssen begann, endet mit Mädchenlachen. Am Ende des 20. Jahrhunderts
stehen wir vor einer ungewissen Zukunft, in einer verwirrenden Welt, verloren
manchmal, verängstigt, verwirrt. Das Grossartige an "Tokyo Eyes" ist,
dass der Film nicht nur diese Stimmung zielsicher einfängt, sondern
dass er darüber hinaus weder fatalistisch noch überhaupt pessimistisch
ist. Im Gegenteil: Ich habe den Film zweimal gesehen, und beide Male kam
ich gutgelaunt aus dem Kino.
|
Uneingeschränkt
empfohlener
Tokyo-Trip |
|
Focus |
Drama,
Japan 1996
R: Satoshi Isaka D: Tadanobu Asano, Keiko Unno, Akira Shirai, Tetsuro Sano Link: Filmausschnitt |

* Was dennoch relativ harmlos beginnt wird zu tödlichem Ernst. Denn der junge Mann hat ein besonderes Hobby: er hört mit einem speziellen Empfänger anderer Leute Telefongespräche mit. Auch dies will die TV-Crew hautnah miterleben, und so bekommen sie bei laufender Kamera ein Gespräch zwischen zwei Gangstern mit, welche die Übergabe einer Pistole via Schliessfach besprechen. Während Kanemaru das Ganze schon zu weit geht, hat der Reporter Iwai jetzt "Blut geleckt", ihn dürstet es nach einer noch spektakuläreren Story - und er holt selbst die Waffe aus dem Schliessfach. Das Unheil nimmt weiter seinen Lauf, bis zur Katastrophe... "Focus" ist ein sehr aufwühlender
Film. Dies kommt unter anderem daher, dass er mit nur einer Kamera gedreht
wurde, der Kamera der TV-Crew - oft unscharf, verwackelt. Man sieht also
alles so, als wäre man mittendrin. Und das ist man ja eigentlich auch.
Dabei ist der junge Mann
keinesfalls ein Unbeteiligter. Seine Obsession, anderer Leute Gespräche
abzuhören, steht als Sinnbild für die Tendenz in unserer Gesellschaft,
jede Privatsphäre zu zerstören, jede Schamgrenze zu übertreten.
Er dringt in fremder Leute Leben ein, so wie nun die TV-Crew in seines
eindringt.
Besonders eindrücklich auch die lange Autofahrt durch das nächtliche Tokyo, bei der aus dem Funk-Empfänger ein chaotischer Wortbrei zerstückelt aufgefangener Telefongespräche quillt, so dass man das Gefühl bekommt, nicht nur die konkrete Stadt, sondern auch das sie überspannende Meer aus Gefühlen und Gedanken zu bereisen. Im stetig wuchernden Netz von sinnlosen Informationen zu treiben. Ganz am Ende schliesslich, und ich kann mir kaum ein besseres Ende vorstellen, wird die Geschichte nicht gefällig aufgelöst oder sonstwie abgerundet. In einem Film wie diesem, in einer Zeit wie der unseren, da kommt das Ende einfach dann, wenn der Kamera die Batterie ausgeht... |
Spannende
Idee,
packend und konsequent umgesetzt - man denkt länger darüber nach |
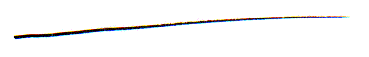
 |
 |
 |
*
Alle Texte, Bilder & Ideen auf dieser Page - (c) 1998 & 1999 Moritz Gerber